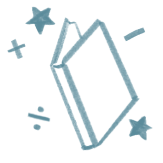2. Beschreibung der Lernsituation
- Kompetenzbindung und Sicherheit
Mats kann im Zahlenraum bis 100 Mengen erfassen, Stellenwerte unterscheiden und einfache Aufgaben im Kopf lösen – solange keine Strategiewechsel nötig sind. Sobald jedoch Rechenoperationen mit Zehnerübergang auftreten, greift er auf zählende Verfahren zurück. Dies deutet auf unsichere innere Vorstellungen vom Zahlenraum und ein fehlendes Vertrauen in flexible Rechenstrategien hin. Stellenwertfehler und Rechts-Links-Unsicherheit (z. B. ‚8 + 5 = 31‘; dabei die ‚1‘ spiegelbildlich) sind nicht selten. Zusätzliche Fehlerquelle: Konzentrationsschwierigkeiten/Ablenkbarkeit.
Im praktischen Handeln, im Sportunterricht und in den Förderstunden zeigt Mats Zutrauen in seine Fähigkeiten und ist anstrengungsbereit. Im Regelunterricht wirkt er oft gehemmt und wenig belastbar: Ihm fehlt das Sicherheitsgefühl und er zieht sich dann innerlich zurück.
Mats ist sprachlich und sozial gut integriert, aber positive Leistungserfahrungen bleiben auf bestimmte „Inseln“ begrenzt. Mitarbeit und
Anstrengung wird für ihn oft zum Risikofeld.
- Unterstützung für aktives Lernen
Mats gelingt der Wissenserwerb, wenn Lerninhalte konkret, kleinschrittig und handlungsbezogen vermittelt werden – wie es im Förderunterricht der Fall ist. Dort unterstützen ihn die ruhige Atmosphäre, die individuelle Anleitung und das angepasste Tempo. Unter diesen Bedingungen zeigt er Bereitschaft, sich auf neue Aufgaben einzulassen, und kann Lernfortschritte erzielen.
Im regulären Unterricht hingegen stößt Mats schnell an seine Grenzen: Hohes Lerntempo, komplexe Aufgabenstellungen und eine reizintensive
Umgebung überfordern ihn. Obwohl ihm grundlegende mathematische Konzepte wie das Stellenwertsystem „theoretisch“ bekannt sind, gelingt ihm die Anwendung auf neue Kontexte nicht zuverlässig. Ohne
gezielte Hilfen fängt er gar nicht erst an oder bricht ab und zieht sich innerlich zurück. Neue Anforderungen erscheinen ihm oft als unüberwindbar und er resigniert.
All das zeigt, dass es ihm an Lernarrangements fehlt, die ihn aktiv einbinden und motivieren.
- Psychologische Stimmigkeit
In Mathematik ist Mats oft angespannt. Hier haben Misserfolgs-erfahrungen dominiert und zu einem dauerhaften Gefühl der Überforderung geführt. Mit seinem ausgeprägten „Ich kann das nicht“ - Erleben zieht er sich bei neuen Lernanforderungen zurück und wird unruhig.
In geschützten Settings – etwa im Sport oder im Förderunterricht – zeigt sich Mats entspannter, emotional zugänglicher und lern-bereiter. Diese Situationen bieten ihm verlässliche Strukturen und emotionale Sicherheit.
Im Klassenverband hingegen fehlen ihm Anerkennung, helfende Kontrolle und emotionaler Rückhalt. Die belastete Beziehung zur Klassenlehrerin und die ungenügende Differenzierung verstärken seine Anspannung zusätzlich.
Auch familiär sind die Rahmenbedingungen ambivalent: Zwar gibt es Unterstützung, doch die psychische Erkrankung des Vaters kann eine
zusätzliche emotionale Belastung für Mats sein.
- Aufmerksamkeit und Selbststeuerung
Mats zeigt in den oben genannten, für ihn klar strukturierten Situationen Motivation, Ausdauer und Konzentration. Im Regel-unterricht hingegen wirkt sein Lernverhalten passiv, ungerichtet und bricht schnell ab. Ohne genaue Anleitung weiß er nicht, was er tun soll. Besonders bei offenen Aufgaben oder bei freier Wahl zieht er sich zurück.
In Mathematik erlebt er sich in der Klasse durchgängig als über-fordert, was zu emotionaler Distanz und geringer Bereitschaft zur Anstrengung und zu Konflikten in der Lehrer-Schüler-Beziehung führt. Lernfortschritte werden von ihm kaum wahrgenommen oder abgewertet.
Fazit: Mats erlebt Lernen – vor allem in Mathematik – stark von Misserfolgen und Überforderung geprägt. Während er in geschützten, spielerisch angelegten Förderstunden Zutrauen und Anstrengungsbereitschaft zeigt, zieht er sich im Klassenunterricht innerlich zurück. Fehlende Sicherheit, belastetes Lehrer-Schüler-Verhältnis und das für ihn zu hohe Tempo des Voranschreitens verstärken sein negatives Selbstkonzept. Zugleich verfügt er über soziale Stärken, sportliche Kompetenzen und kann in günstigen Settings Motivation entwickeln. Seine Lernsituation ist daher widersprüchlich: Inseln der Sicherheit und Lernbereitschaft stehen einer dominierenden Erfahrung von Scheitern gegenüber. Entscheidend ist, diese Inseln bewusst zu erweitern und in den schulischen Alltag einzubetten, sodass sie nicht Ausnahmen bleiben, sondern zum neuen Standard werden.